Champagner ist ein wunderbares Getränk, das uns seit Jahrzehnten begleitet. Und da bekanntlich Wissen den Genuss erhöht (wie Henry Miller treffend bemerkte) haben wir uns immer wieder mit Allem rund um den Schampus beschäftigt. Doch man lernt nie aus und so kamen bei unserer letzten Reise durch die Champagne wieder ein paar neue Erkenntnisse hinzu.

Was wir nicht wussten: bei der Champagner-Produktion ist das „Chaptalisieren“ der Grundweine zulässig und offenbar auch weit verbreitet.
Was hat es damit auf sich? Die „Chaptalisation“ ist ein vom französischen Chemiker Jean-Antoine Chaptal (1756-1832) vor gut 200 Jahren erfundenes Verfahren, den Alkoholgehalt des Weins durch Zuckerzugaben bei der Gärung zu erhöhen. Damit können „schwache“ Jahrgänge mit zu wenig Sonne verbessert werden. In Deutschland ist das Chaptalisieren nur bei einfacheren Weinen erlaubt und bei Prädikatsweinen nicht zulässig.
Welche Auswirkungen die Chaptelisationauf den Geschmack des Champagners hat konnte uns bislang noch niemand beantworten. Und es ist wohl auch nicht so leicht herauszufinden, denn die Champagnerhersteller behalten gern für sich, ob und in welchem Umfang sie auf diese Weise ihre Grundweine verbessert haben. Bei einer Kellerführung bei „Veuve Cliquot“ wurde dieser Produktionsschritt allerdings erläutert, was uns auf das Thema aufmerksam machte.

Üblicherweise wird das Thema in der Champagne nicht an die große Glocke gehängt. Auf der Website des „Comité Champagne“ wird uns zwar fast Alles und Jedes bis in die letzten Facetten erklärt, vom Chaptalisieren ist aber nie die Rede.
Auch über das Degorgierdatum wird kein Wort verloren – dazu später mehr.
Bleiben wir einen Moment beim Chaptalisieren. Die Anbaugebiete der Champagne sind klimatisch eher schwierig. Die Sommer sind oft kalt und regnerisch und wirklich ausreifen können die Trauben nur in bevorzugten Lagen (den „Grands Crus“). Doch die Kellermeister bringen es fertig, gerade mit diesen Weinen exzellente, spritzige Champagner zu kreiieren.

Die Anbauflächen sind klar definiert – nur Weine aus genau festgelegten Lagen dürfen zu Champagner verarbeitet werden. Die Champagnerproduzenten geben sich große Mühe, immer neue Märkte für ihre Produkte zu erschließen – doch eine Ausweitung der Anbauflächen ist nicht möglich. Und schlimmer noch: In schlechten Jahren erreichen auf etlichen Hängen die Trauben bedauerlicherweise nicht den nötigen Zuckergehalt. Um sie dennoch zu Champagner verarbeiten zu können (und um die Mengen liefern zu können, für die mit großem Aufwand Märkte erschlossen wurden) kommt die „Sonne aus dem Sack“ zum Einsatz. Die Sache ist auch in der Champagne nicht unumstritten. „Puristen“ plädieren dafür, auf die Zuckerzugaben zu verzichten und statt dessen auf mehr Sorgfalt im Weinberg zu setzen. Bislang ist das allerdings eine Minderheitsmeinung.
Kommen wir zum Degorgierdatum und damit zum zweiten wichtigen Thema, über das auf der offiziellen Champagner-Seite im Internet kein Wort verloren wird.

Champagner sollte nicht zu lang aufbewahrt werden, so erfährt der Genussfreund bei jeder Verkostung. Am Besten sei es, ihn innerhalb von 2-4 Jahren auszutrinken, denn danach verliere er an Geschmack und Kohlensäure. Doch wann genau beginnt dieser Zeitraum?
Als „trinkfertig“ gilt Champagner (und natürlich auch alle Sekte, die nach traditioneller Methode hergestellt wurden), wenn die Flaschengärung abgeschlossen ist, der Champagner vom Hefedepot befreit und somit „degoriert“ wurde, seine passende Zucker-Dosage erhalten hat und mit einem Korken verschlossen wurde. Das Degorgierdatum ist also der entscheidende Zeitpunkt, an dem sich der Champagnerfreund zu orientieren hat. Doch – oh Wunder – die meisten Hersteller behalten das lieber für sich.
Einige der großen Markenchampagner drucken das Degorgierdatum auf ihre Etiketten, doch das ist absolut freiwillig – es gibt in der Champagne keine Deklarationspflicht. Die Begründungen dafür sind mehr als fadenscheinig („Damit wäre der Verbraucher überfordert“).
Bei Veuve Cliquot steht das Degorgierdatum immerhin auf den Etiketten der Jahrgangschampagner. Bei den „Standard“-Abfüllungen möge man beim Händler fragen, wie schnell man die Flaschen zu leeren habe, erläuterte uns die freundliche junge Dame, die uns durch die Keller führte.

Doch welcher Händler weiß schon, wie alt der Champagner ist, der ihm vom Großhändler angeliefert wurde? Und wie kann der Käufer herausfinden, wie lang eine Flasche schon im Regal stand? Ein amerikanischer Champagnertester brachte es auf den Punkt: „Auf meiner französischen Butter steht das Verpackungs- und Mindesthaltbarkeitsdatum. Dass der Verbraucher auf einer Champagnerflasche, die das Zehnfache kostet, nichts dergleichen vorfindet, regt mich auf.“
Aus der Sicht der Champagnerproduzenten macht es sehr viel Sinn, das Degorgierdatum geheim zu halten, denn damit ergibt sich eine elegante Möglichkeit, Marktschwankungen auszugleichen. Wenn – wie bei der Corona-Epedemie – der Verkauf einbricht, kann man die Flaschen später immer noch zum vollen Preis verkaufen. Bei voller Transparenz wäre das ungleich schwieriger.
2009 führte die weltweite Finanzkrise zu einem Absatzeinbruch beim Champagner. Ebenso ging es bei Corona. Wieviele Millionen Flaschen damals bereits versandfertig degorgiert waren kann man nur mutmaßen. Für die Hersteller aber kein größeres Problem: Sie konnten diese Bestände in den Jahren danach unauffällig auf den Markt bringen.
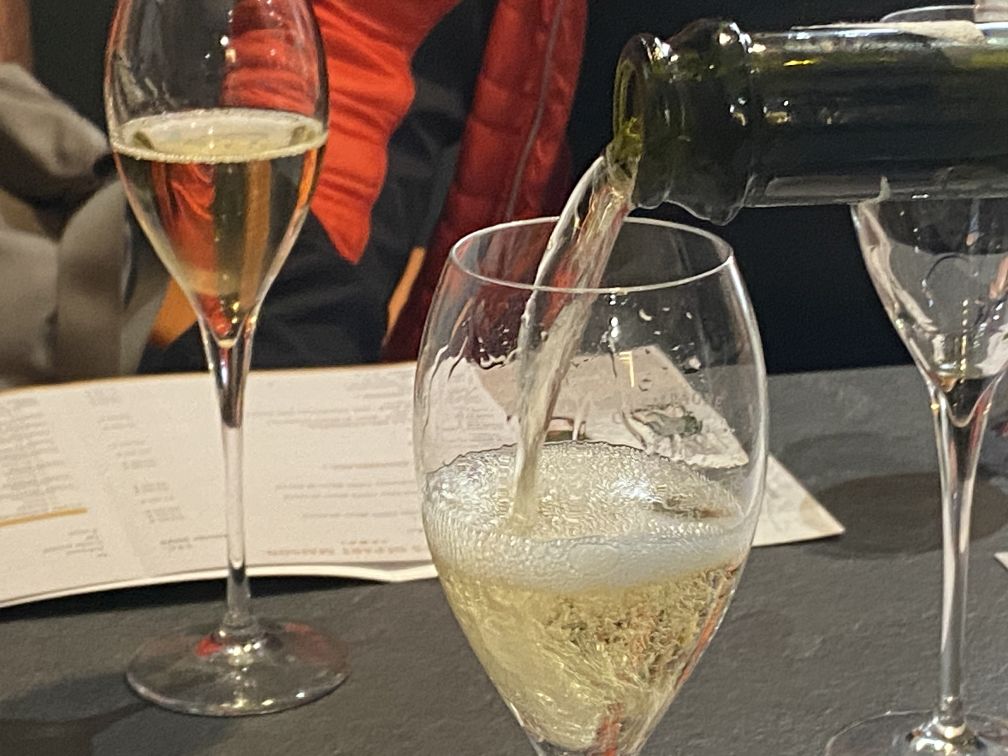
Champagner verändert sich mit der Zeit in der Flasche. Und schmeckt – so die einhellige Expertenmeinung – am besten kurz nach dem Degorgieren. Das liefert uns auch die Erklärung für das überraschende Ergebnis von einem unserer Champagner-Tastings: Bei einer Blindverkostung landete ein teurer Markenchampagner zu unserer Verblüffung abgeschlagen am Ende des Starterfeldes. Wir wollten das nicht so recht glauben und kauften (bei einem anderen Händler) eine neue Flasche. Und die schmeckte dann wirklich gut.

